HIV/AIDS Geschichte
Haus 68 – Rückblick in Erinnerungen


Dr. Thomas Lutz – 1992 und heute
Infektiologikum Frankfurt
Arzt im Haus 68 1989–2001
Dr. Thomas Lutz
„Menschen, die das Unmögliche möglich machten“
Meine Erinnerungen reichen zurück in die 1980er Jahre. Schon als Student führte mein Weg regelmäßig an diesem
zweistöckigen, grauen Betonbau vorbei – einem äußerlich abweisenden architektonischen Relikt der 60er oder 70er Jahre.
Der „Pockenbau“ lag am Rande des Klinikgeländes, hinter den Bahngleisen, die nur durch eine Unterführung passierbar
waren. Im Erdgeschoss befanden sich die Tuberkulose- und Infektionsstation, darüber die Infektionsambulanz. Bald wussten
wir, dass das Gebäude die AIDS-Station beherbergte – eine noch neue und
bedrohliche Krankheit. Treffend nannte ein
Dokumentarfilm von 1987 die Station „Das Haus am Ende des Tunnels“ – Sinnbild für die Lage des Gebäudes sowie die
gesellschaftliche Ausgrenzung der Betroffenen, auch im Medizinbetrieb der 80er und 90er Jahre.
Trostloses Gebäude

Haus 68

Stationszimmer morgens mit vorbereiteten Infusione© Photos: Thomas Lutz
Ende der 1980er Jahre lernte ich dann auch das Innere des Hauses kennen – zunächst im Rahmen meiner Doktorarbeit bei Frau Professorin Eilke Brigitte Helm, später als Arzt im Praktikum und Assistenz in der infektiologischen Abteilung. Das Gebäude wirkte innen so trostlos wie von außen: dunkle Flure, angestoßene Wände, fensterlose bis unter die Decke gekachelte Stationszimmer, abgenutzte Möbel, grelles Neonlicht. Und doch war dieser Ort für mich prägend wie kaum ein anderer.
Im Juli 1992 begann ich dort meine Tätigkeit auf der AIDS-Station – aufgeregt, neugierig, und bald schon tief beeindruckt. Die folgenden Jahre waren arbeitsreich und fordernd, aber auch unvergesslich lehrreich. Ich sah das Vollbild von AIDS, wie es sich heute kaum mehr vorstellen lässt. Viele Patienten waren jung – in unserem Alter, manche gar jünger. Einige kamen immer wieder, die Intervalle zwischen den Aufenthalten verkürzten sich, bis sie schließlich auf Station starben. Zu unseren Aufgaben gehörte leider auch, das Sterben zu begleiten, es möglichst schmerz- und angstfrei zu ermöglichen – und mit der Ohnmacht angesichts der Grenzen der Medizin umzugehen.
Konsil und Visite
Der Alltag war geprägt von Aktivitäten und Visiten sowie den Konsilen der Kollegen und Kolleginnen aus Onkologie, Neurologie und Dermatologie. Lange bevor interdisziplinäre Boards üblich waren, wurden hier bereits die Fälle direkt am Patientenbett besprochen. Im Zentrum stand stets Frau Professor Helm – fachlich brillant, menschlich zugewandt, unermüdlich im Einsatz für Patienten und Team. Sie prägte die Station und die gesamte Abteilung wie keine andere. Und so verbinde ich die Erinnerung ans Haus 68 auch mit Helmine – wie sie liebevoll im Team genannt wurde. Sie selbst hatte ihre eigene und viel weiter zurückliegende Geschichte mit dem Haus 68 als sie sich 1967 mit Patienten, die an einem damals noch unbekanntem hämorrhagischen Fieber litten, als Assistenzärztin isolieren ließ, um diese zur versorgen. Es handelte sich um das bei diesem Ausbruch erstbeschriebene Marburgvirus.
Solidarität

Prof. Eilke Helm *1936 † 2023
Trotz aller Härte war die Atmosphäre im Haus 68 nicht trostlos. Neben Leid, Angst und Tod standen Nähe, Solidarität und Lebensgier. Angehörige blieben oft bis spät in die Nacht, Ehrenamtliche kochten einmal pro Woche für Patienten und Team. Im Sommer gab es ein gemeinsames Fest und ein ehrenamtlich betriebenes Patientencafe. Die Stimmung war unkonventionell, offen und herzlich – getragen von Pflege, Ärzteschaft und Ehrenamtlichen, die den Erkrankten ohne Vorurteile begegneten.
Medizinischer Durchbruch
In meinen darauffolgenden Jahren in der HIV-Ambulanz erlebte ich Mitte der 1990´er Jahre hautnah den medizinischen Wandel. Ich erinnere mich noch recht genau, wie ungläubig ich war, als ich die ersten schwer immunsupprimierten und erkennbar totgeweihten Patienten 1995 mit dem Proteaseinhibitor Indinavir behandeln durfte. Bereits nach wenigen Wochen wurde sichtbar, welcher der Patient im Rahmen der randomisierten Studie das Prüfmedikament erhalten hatte – ein Therapiedurchbruch, der alles veränderte. Ich fühlte mich als Teil von etwas Großem. Wir erlebten, wie klinische Forschung Hoffnung schenkt – und wie aus einem Ort des Sterbens langsam ein Ort der Zukunft wurde.

Prof. Dr. Christoph Stephan
Universitätsklinikum Frankfurt
Arzt im Haus 68 bis heute
Prof. Dr. Christoph Stephan
„Erste 3er-ART“
Im Haus 68 war, solange ich mich erinnere, die Station und die Ambulanz für Menschen, die mit HIV leben, und dazu gehörte auch oft, besonders am Anfang, das Sterben mit und an HIV dazu. Es wurden dort aber auch große Erfolge gefeiert, die einzigartig waren. Erstmalig konnte hier eine Dreifachkombination als „antiretrovirale Therapie“ erfolgreich angewandt werden. Damit verbunden war viel Hoffnung, aber auch Nebenwirkungen, oft anfangs ein teuer erkaufter Preis für den Therapieerfolg.
Michaela Bracone
„Mehr als ein Arbeitsplatz“

Michaela Bracone
Pflege in Haus 68 1984–2010
Prof. Schlomo Staszewski
Ärztlicher Leiter Haus 68 bis 2007
Meine Geschichte begann 1983 in den städtischen Kliniken Darmstadt, wo ich als Auszubildende zur Krankenschwester die Aufnahme eines der ersten HIV-Patienten erlebte. Die Schutzanzüge, die Atmosphäre – es wirkte wie eine andere Welt, fast wie in einem Raumschiff. Damals wurde mein Interesse an dieser neuen, unbekannten Erkrankung geweckt. Nach meiner Ausbildung erzählte mir eine Kollegin begeistert von ihrer Arbeit im Haus 68. Ihre Worte ließen mich nicht mehr los. Ich bewarb mich – und stand kurze Zeit später selbst dort, mitten in einem Ort, der so viel mehr war als eine gewöhnliche Ambulanz.
Geprägt wurde das Haus 68 für mich von Professor Schlomo Staszewski. Mit seiner Energie, seiner Menschlichkeit und seinen Visionen hat er diesen Ort zu dem gemacht, was er war. Unter seiner Leitung wurde das Haus 68 zu einer Gemeinschaft, die weit über medizinische Versorgung hinausging – zu einem Ort, der für viele Heimat, Zuflucht und Hoffnung zugleich war.
Das Haus 68 war voller Gegensätze. In der Routineambulanz begleiteten wir schwerkranke Menschen, deren letzte Lebensphase wir so würdevoll wie möglich gestalten wollten. Direkt gegenüber, in der Studienambulanz, sah man junge Männer, frisch infiziert, voller Hoffnung auf neue Therapien. Sterben und Neubeginn lagen nur wenige Schritte auseinander.
Wir haben unzählige Menschen ein Stück ihres Weges begleitet – manche bis zum Ende. Wir haben gemeinsam gelacht, geweint, gebangt und gehofft. Für jeden, den wir verloren haben, brannte eine Kerze in unserem Personalraum den ganzen Tag. Es war unser kleines Ritual, ein Symbol der Nähe. Es half uns, die Schwere auszuhalten – und zugleich die Dankbarkeit für jeden gemeinsam gelebten Moment nicht zu verlieren.
Eine besondere Begegnung für mich war auch das Zusammentreffen mit Schwester Helga Weidemann. Sie war Seelsorgerin am Klinikum und für viele Patientinnen und Patienten im stationären Bereich eine der wichtigsten Begleiterinnen – besonders in ihrer schweren Krankheits- und leider oft auch Sterbephase.
Freiwillige Helfer
Ganz wesentlich für den Geist des Hauses waren auch die „Ehrenamtlichen“. Zunächst entstand über den Seelsorgebereich ein Patienten-Cafe – ein kleiner Raum, in dem täglich Kaffee gekocht und Kuchen gebacken wurde. Es spielte keine Rolle, ob jemand Patient, Ärztin, Pfleger oder Reinigungskraft war – man saß zusammen, aß zusammen, lebte zusammen. Es entstand eine große Gemeinschaft, die schwer zu beschreiben ist. Wer sie nicht erlebt hat, kann kaum ermessen, wie tief sie getragen hat – und wie sehr man sie vermissen kann.
Doch es war nicht nur die Nähe zu den Patientinnen, die Haus 68 so besonders machte. Auch wir Mitarbeitenden waren freundschaftlich miteinander verbunden. Wir stützten uns gegenseitig, gaben einander Halt und Kraft, wenn die Schicksale zu schwer wurden.
Schmerz und Hoffnung
Von 1994 bis 2010 war ich als Gruppenleitung im Haus 68 tätig – mit Verantwortung für Organisation, Team und vor allem für die Menschen, die uns anvertraut waren. In diese Zeit fiel auch die Mitorganisation des DÖAK-Kongresses. Es war ein Höhepunkt, aber zugleich ein schmerzlicher Moment: Denn kurz vor diesem großen Ereignis, das er inhaltlich selbst vorbereitet und geprägt hatte, musste sich Professor Staszewski aufgrund einer schweren Erkrankung zurückziehen. Für viele von uns war es, als würde das Fundament des Hauses ins Wanken geraten.
Heute weiß ich: Haus 68 war für mich nie nur ein Arbeitsplatz. Es war ein Teil meines Lebens. Ein Ort voller
Schmerz, Hoffnung, Gemeinschaft und Stärke. Ein Ort, der mich geprägt hat und dessen Geist ich bis heute in meinem neuen
Arbeitsfeld weiterzutragen versuche.

2007 Pavel Khaykin Arzt im Haus 68 2004–2010 und Michaele Bracone

2025 in der Praxis MainFachArzt
Pavel Khaykin
„Mehr als nur ein Gebäude“
2004 kam ich als EACS-Stipendiat aus der Ukraine an das Universitätsklinikum Frankfurt am Main, zur HIV-Ambulanz in Haus 68. Diese Einrichtung war eine Legende in der deutschen HIV-Behandler Szene.
Ich hatte mir diesen Ort bewusst ausgesucht, begeistert von den wissenschaftlichen Veröffentlichungen über damals revolutionäre HIV-Therapien, geleitet vom damaligen Leiter der Ambulanz: Professor Schlomo Staszewski – der erste und damals einzige HIV-Professor in Deutschland.
Rückblickend war Haus 68 als Gebäude schon etwas in die Jahre gekommen. Für mich aber war es ein Raumschiff – mit einer einzigartigen Atmosphäre. Ich wurde vom ersten Tag an aufgenommen wie ein vollständiges Teammitglied. Es gab keine Vorurteile, keine Distanz – obwohl ich damals vor allem Englisch sprach und mein Deutsch noch stark akzentbehaftet war. Trotzdem fühlte es sich an, als hätte ich dort schon immer gearbeitet.
Guter Start
Es war für mich neu, dass man den Chef duzen durfte. Und dass ich schon am ersten Tag neben Frau Dr. Amina Carlebach in ihrer Sprechstunde sitzen durfte – einfach so, ohne große Einführung, sofort Teil des Alltags. Ich durfte Patient:innen se-hen, Studien betreuen, Projekte begleiten. Auch die Bürokratie, vor der ich großen Respekt hatte, war plötzlich handhabbar. Ich glaube, das lag nicht zuletzt an Haus 68 – und an Prof. Staszewski.
Mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die ich für immer mit Haus 68 verbinden werde, habe ich viele schöne, aber auch tragische Momente erlebt. Besonders prägend war für mich die Vorbereitung des DÖAK-Kongresses in Frankfurt, während unser Chef schwer erkrankte. Es war eine herausfordernde Zeit, in der wir als Team noch enger zusammenrückten.

Stationsflur Haus 68© Photo: Thomas Lutz
Gemeinschaft
Für unsere Patient:innen war Haus 68 ein besonderer Ort. Nicht nur wegen der medizinischen Behandlung, sondern vor allem wegen der Menschen, die dort arbeiteten – Krankenschwestern, Rezeptionistinnen, Studienkoordinator:innen, Aktivist:innen. Es gab Tage, an denen in der Küche Suppe für alle gekocht wurde – für Patient:innen in der Ambulanz oder auf Station. Viele meiner Patient:innen fragten mich beim Praxiswechsel, ob sie mitkommen dürften. Einer sagte sogar: „Ich gehe mit Ihnen mit – aber Haus 68, das bleibt für mich.“ Und dann fügte er hinzu: „In Ihrer neuen Praxis wird’s wahrscheinlich keine Tage geben, an denen Suppe gekocht wird.“ Haus 68 war nie nur ein Gebäude. Es war ein Geist. Eine Haltung. Eine Gemeinschaft.
Und ich werde immer ein Teil davon sein.
 Dr. Annette Haberl
Dr. Annette Haberl
Ärztin im Haus 68
1996 bis heute
Dr. Annette Haberl
„Eine Hausnummer mit Geschichte“
Dreifachkombinationen für Drogengebrauchende mit HIV? Mitte der 1990er-Jahre war da noch Zurückhaltung angesagt. Zu komplexe Einnahmemodalitäten, Gefahr des Therapieversagens, mögliche Ausbreitung von Resistenzen. Bedenken eben. Nicht so im Haus 68. Ich wurde dort 1996 mit einem klaren Zielauftrag eingestellt: Eine Spezialsprechstunde für Drogengebrauchende mit HIV aufzubauen und in Zusammenarbeit mit den Frankfurter Substitutionsambulanzen eine Studie mit der allerersten einmal täglichen ART durchzuführen. Nevirapin, 3TC und ddI. So konnten bei Bedarf sogar ART und Methadonvergabe kombiniert werden. Für die Umsetzung des Projekts hatte ich einen Gestaltungsfreiraum, der typisch war für die Arbeit im Haus 68. Sprechstundenzeiten mussten ja nach hinten verlegt, Termine flexibel gehalten und Besprechungen in Vergabestellen organisiert werden. Alle im Team waren offen für die Veränderungen; sicher auch getragen von einer spürbar neuen Dynamik im HIV-Bereich. Ohne letzte Gewissheit zu haben, war uns damals bereits klar, dass wir in der HIV-Therapie den entscheidenden Wendepunkt erreicht hatten. Das war schon ein tolles Gefühl, dabei sein und mitgestalten zu dürfen.
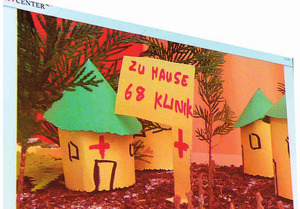
© Helping Hand
Der Erfolg der ART wurde schnell sichtbar in der Sprechstunde und Patient*innen fingen an, wieder Pläne für die Zukunft zu machen. So verwirklichten auch Frauen mit HIV jetzt endlich ihren Kinderwunsch. Neue Aufgaben also für´s Team und typisch Haus 68: Es folgte bereits 1999 die Einrichtung der deutschlandweit ersten interdisziplinären Sprechstunde für Schwangere mit HIV. Was auch noch folgte war die Anschaffung von Bobbycars für die schönen langen Ambulanzflure, die Einrichtung einer Kinderspielecke und die Organisation von Nikolausfeiern. Im Haus 68 wurde nie „nur“ Medizin gemacht.
Beim Thema Schwangerschaft bzw. Frauen mit HIV bin ich dann all die Jahre hängengeblieben, genauso wie im Haus 68, das für mich beruflich zur Heimat wurde. Und Heimat darf man schon auch manchmal vermissen.
Dr. Ulrich Meyer-Bunsen
 Dr. Ulrich Meyer-Bunsen
Dr. Ulrich Meyer-Bunsen
Mitarbeiter bei BMS und J&J
2004 bis heute
„Wirklich legendär!“
Im Juli 2004 startete ich im Außendienst HIV von Bristol Myers Squibb. Meine erste Station war tatsächlich das damals schon legendäre Haus 68 an der Universitätsklinik Frankfurt. Schlomo Staszewskis Team entwickelte HIV-Therapie weiter und prüfte neue Therapieprinzipien in Studien. Wer erinnert sich noch an die 3TC-Monotherapie als Überbrückungsstrategie? Eine in Frankfurt populäre Strategie wurde dann die Doppel-PI-Therapie! Lange Diskussionen um einzelne Patienten in der Umstellungssprechstunde, um bei komplexer Resistenzlage noch eine wirksame Therapie zu finden. Wahrlich legendär!

Team Haus 68 – April 2007© Annette Haberl
 © Uni Frankfurt
© Uni Frankfurt
Wie geht es weiter?
Auch wenn das Haus 68 nicht mehr ist, mit der Frankfurter Infektiologie geht es weiter. Die Infektiologie ist von dem stark renovierungsbedürftigen 60er-Jahre Bau in den Neubau umgezogen. Die neue infektiologische Station im Gebäudeteil Haus 23F bietet strukturelle Verbesserungen entsprechend den aktuellen infektionsmedizinischen Standards und optimal auf die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit hochkomplexen oder hochinfektiösen Erkrankungen ausgerichtet. Die Patientenzimmer sind größtenteils als Einzelzimmer mit vorgelagerten Schleusenräumen konzipiert, um höchsten hygienischen Standards gerecht zu werden.









 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen