Dah: 10 Jahre Buddy.Hiv
Peer-Unterstützung nach der Diagnose

Buddies Bert und Fabian lernten sich über Buddy.hiv kennen
Auch wenn die medizinischen Perspektiven für Menschen mit HIV heute sehr gut sind, bleibt die Diagnose für die meisten ein einschneidender Moment. Der emotionale Ausnahmezustand, das Gefühl von Scham, Angst oder Isolation, lässt sich nicht allein durch medizinische Fakten auflösen. Viele haben noch zu dramatische Vorstellungen vom Leben mit HIV im Kopf. Und nach der Diagnose stellen sich jede Menge Fragen, die in der ärztlichen Praxis nicht ausführlich beantwortet werden können.

Leben mit HIV: Fabian bekam Starthilfe © Fotos: DAH Dietrich Dettmann
Keiner muss alleine bleiben
Das zeigt exemplarisch die Geschichte von Fabian aus Bottrop, der seine Diagnose mit Ende 20 mitten in der Covid-Pandemie erhielt. „Medizinisch war alles schnell geregelt, aber psychisch ging es mir schlecht. Ich habe mich dreckig gefühlt, schmutzig – ja, das waren wirklich die Worte, die ich über mich selbst gedacht habe“, berichtet er. Obwohl sein Partner ihn unterstützte, blieb das Gefühl, mit der Situation allein zu sein. Über eine Internetrecherche stieß Fabian auf buddy.hiv und nahm Kontakt zu Bert aus Dortmund auf, der seit 2004 mit HIV lebt und seit 2017 als Buddy aktiv ist als Unterstützer und Role-Model.
Peer-Unterstützung auf Augenhöhe
Schadensminimierung
Städte
auf synthetische Opioide vorbereiten
Wie
können Städte auf die Ausbreitung synthetischer Opioide und deren
Gefahren reagieren? Antworten auf diese Frage und konkrete Maßnahmen
entwickelt ab sofort das Projekt so-par. Die Deutsche Aidshilfe und
das Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit (Defus)
kooperieren dabei mit den Städten Hannover, Essen und Berlin. so-par
steht für „Synthetic Opioids Prepare and Response“. Ziel ist es,
Akteur*innen des öffentlichen Gesundheitswesens,
Behörden,
Fachkräfte der Suchthilfe sowie Konsumierende zu informieren und zu
befähigen, in Krisensituationen zu handeln. Kernelemente sind
Krisenkommunikationspläne, eine Awareness-Kampagne sowie lebensnahe
schadensminimierende Maßnahmen, Drogenmonitoring, Naloxon-Trainings
und ein Informationsportal. Nach der Implementierung und Erprobung
soll eine „Blaupause“ für weitere Städte entstehen.
Der Grund für dieses Projekt: In Deutschland gelangen immer mehr synthetische Opioide auf den Markt. Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis warnen vor einer wachsenden Bedrohung, denn die synthetischen Substanzen sind deutlich potenter und schwerer zu dosieren als Heroin – und damit besteht ein höheres Risiko für tödliche Überdosierungen. In deutschen Städten wie Bremen und Frankfurt wurden Fentanyl oder Nitazene als Beimengung in Heroinproben nachgewiesen. In Großbritannien und Irland hat die Verbreitung synthetischer Opioide bereits zu schweren und tödlichen Überdosierungen geführt.
In Deutschland stieg die Zahl der drogenbedingten Todesfälle 2023 auf 2.027; bei mehr als der Hälfte der Fälle spielte der Konsum von Opioiden eine Rolle.
Hintergrund: Die drastische Reduzierung der Schlafmohnproduktion in Afghanistan führt zu einer Verknappung von Heroin, die durch die verstärkte Verbreitung synthetischer Opioide wie Fentanyl oder Nitazene kompensiert wird.
Das
Projekt so-par setzt die Bestrebungen der Deutschen Aidshilfe fort,
der aktuellen Situation etwas entgegenzusetzen und Akteur*innen auf
die neue Lage vorzubereiten. Zuletzt hat die DAH im BMG-geförderten
Projekt RaFT (Rapid Fentanyl Testing in Drogenkonsumräumen)
untersucht, inwieweit Fentanyl in Deutschland
bereits Heroin
beigemischt wird.
so-par wird von Prof. Dr. Daniel Deimel, der Technischen Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohm und dem Team vom NEWS-Projekt des Institut für Therapieforschung unterstützt und beraten.
Kontakt:
sopar@defus.de
Das erste Treffen der beiden fand pandemiebedingt in einer Einkaufspassage statt – ungewöhnlich, aber wirkungsvoll. „Es war sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen, der sich in der gleichen Situation befindet und so selbstbewusst mit seinem Status umgeht. Ich habe mich direkt weniger allein und schmutzig gefühlt“, erinnert sich Fabian. Bert habe ihm gezeigt, dass es weitergeht, ganz normal, vielleicht sogar besser. „Zudem bekam ich Antworten auf Fragen, die mir niemand anderes hätte geben können.
Bert beschreibt seine Motivation als Buddy so: „Für mich ist das ein Akt der Solidarität – Menschen, die sich in einer tiefgreifenden Krise befinden, kurzfristig zur Seite stehen.“ Buddys wie Bert werden von der Deutschen Aidshilfe geschult, bringen Infomaterial mit, hören zu und teilen ihre Erfahrungen. Sie sprechen gezielt auch sensible Themen an. „Ich rede beim ersten Treffen auch gerne schon über mögliche Diskriminierungserfahrungen – gerade im Gesundheitsbereich –, weil viele Menschen das unmittelbar nach der Diagnose erleben. Es ist wichtig, ihnen zu zeigen, dass sie Rechte haben und nicht hilflos ausgeliefert sind“, sagt Bert.
Individuelle Begleitung – flexibel und bedarfsorientiert
Die Kontaktaufnahme erfolgt unkompliziert über www.buddy.hiv. Die Begleitungen sind individuell: Manche Kontakte laufen per E-Mail oder Telefon, andere persönlich. Die Themen reichen von Fragen zur Therapie über Unsicherheiten im Arbeitsleben bis hin zu Coming-out und Diskriminierung. Besonders wertvoll ist der Austausch auf persönlicher Ebene. „Es geht um das, was ein Buch oder das Internet nicht leisten kann – diese persönliche Ebene“, betont Bert. Fabian bestätigt: „Das Buddy-Projekt war mein erster Schritt nach außen. Dank Bert habe ich gemerkt, wie gut es tut, sich aktiv einzubringen, und habe über ihn später auch andere Positive kennengelernt und eine Community gefunden.“
Wirkung und Bedeutung für die Praxis
In den ersten zehn Jahren des Projekts haben 1.001 Menschen Unterstützung erhalten. 117 Buddys wurden ausgebildet, 64 davon engagieren sich aktuell bundesweit. Die Rückmeldungen sind durchweg positiv: Nutzer*innen berichten von spürbarer Entlastung, neuer Zuversicht und nachhaltiger Stärkung ihres Selbstwertgefühls. Viele engagieren sich später selbst in der Community.
Auch für Ärzt*innen und Praxisteams ist buddy.hiv eine wichtige Ressource. Dr. Hubert Schulbin, Schwerpunktarzt in Berlin-Kreuzberg, beschreibt es so:
„Im Praxisalltag ist meist nicht genug Zeit, alle Fragen ausführlich zu behandeln, da mit jeder Antwort in so einer Belastungssituation neue Fragen auftauchen. Und die Erfahrung eines Menschen, der die gleiche Krise schon bewältigt hat, kann ich als Arzt natürlich nicht ersetzen. Es entlastet mich sehr zu wissen, dass ich Patient*innen in kompetente Hände ,überweisen‘ kann.“
Empfehlung für die ärztliche Praxis
Für Ärzt*innen und Praxisteams bietet buddy.hiv also eine unkomplizierte Möglichkeit, Patient*innen nach der Diagnose gezielt zu unterstützen und ihnen einen niedrigschwelligen Zugang zu Peer-Beratung zu ermöglichen. Info-Materialien zum Buddy-Projekt können kostenfrei über den Online-Shop der Deutschen Aidshilfe bestellt werden. Dazu gehören auch Visitenkarten, die Ärzt*innen ihren Patient*innen mitgeben können. So erhalten sie bereits beim Erstgespräch einen Zugang zu diesem wichtigen Angebot.
Bestellen Sie kostenfrei Informationsmaterial für Ihre Praxis im Online-Shop der Deutschen Aidshilfe:
www.aidshilfe.de/shop
jofre/howi
Weitere Informationen:
www.buddy.hiv





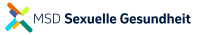



 Diese Seite weiter empfehlen
Diese Seite weiter empfehlen